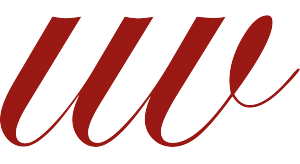Innovation durch Kollaboration
Wie man Kreativität in Projekten fördert und Innovationen umsetzt
von Mario Neumann*
In heutigen Märkten ist es entscheidend, Marktnischen rasch zu erkennen und das Produktportfolio flexibel den Bedürfnissen der eigenen Kundschaft anzupassen. Schnelle Trend- und Bedürfnisanalysen sind unerlässlich, um im Wettbewerb zu bestehen. Co-Creation Ansätze können eine gute Plattform für Innovationen sein, doch allein kreatives Ideensammeln reicht nicht – wie kann man sicherstellen, dass sich der Co-Creation Aufwand wirklich lohnt?
Unter Co-Creation versteht man einen kollaborativen Prozess, bei dem Unternehmen gemeinsam mit Kunden und anderen Stakeholdern innovative Lösungen, Produkte oder Dienstleistungen entwickeln. Durch den Austausch von Ideen, Wissen und Erfahrungen entsteht ein Mehrwert für alle Beteiligten. Co-Creation ermöglicht es, passgenaue Angebote zu schaffen, die den tatsächlichen Bedürfnissen entsprechen.
Der Spielzeughersteller LEGO setzt schon seit vielen Jahren auf einen Co-Creation Ansatz: Lego Ideas. Mit Lego Ideas lädt das Unternehmen aus dem dänischen Billund seine Fans dazu ein, ihre wildesten Bauideen zum Leben zu erwecken. Jeder kann seine einzigartigen Lego-Modelle entwerfen, teilen und zur Abstimmung stellen. Wenn eine Idee genügend Unterstützung erhält, wird sie von Lego geprüft und möglicherweise als offizielles Produkt veröffentlicht. Das Besondere daran ist die enge Verbindung zwischen Unternehmen und Community: Fans werden zu Mitgestaltern, deren Kreativität direkt in den Handel fließt. Diese offene Zusammenarbeit schafft Produkte, die genau den Wünschen der Nutzer entsprechen, und stärkt die emotionale Bindung zur Marke.
Einfach mal machen
Bis Innovationen jedoch wirklich marktreif sind, braucht es weit mehr als nur eine kreative Zusammenkunft mit der eigenen Kundschaft. Der Weg von ersten Rohideen bis hin zu fertigen Produkten und Dienstleistungen erfordert eine sorgfältige und detaillierte Planung, die von Unternehmen oft unterschätzt wird. Neben dem Eventmanagement ist gerade die methodische Gestaltung eines Kundenworkshops von besonderer Bedeutung. Kreativität braucht immer einen festen und gelenkten Rahmen, der durch bewährte Methoden vorgegeben wird. Nur so lassen sich Ideen gezielt generieren und weiterentwickeln.
Ein häufiger Fehler ist die offene Einladung „Lassen Sie uns Ideen sammeln“, ohne klare Strukturen oder Ziele. Das führt oft zu wenig kreativen, ermüdenden Diskussionen. Entgegen der Annahme, dass Einschränkungen Kreativität hemmen, fördern sie diese sogar, indem sie den Fokus auf konkrete Probleme lenken und gezielt Lösungen ermöglichen. Mit moderierten, strukturierten Methoden entsteht ein produktives Umfeld für systematisches Ideenmanagement und erfolgreiche Innovationen.
Passgenaue Methoden
Aus Kreativ- und Innovationstechniken lassen sich individuelle Methoden entwickeln, die Raum für Kreativität bieten, ohne sich ausschließlich auf Problemlösungen oder utopische Visionen zu konzentrieren. Sie verfolgen unterschiedliche Ziele, etwa offene Problemfindung, Bedarfsanalyse oder Inspiration. Dabei entstehen drei unabhängige Module, die jeweils eigenständig ausgewertet werden können, um möglichst viele gute Ideen zu generieren. Jedes Modul sollte eigenständig Ergebnisse liefern, unabhängig vom Erfolg der anderen.
■ Problemolympiade
Im ersten Teil des Workshops wird eine modifizierte Version des klassischen Brainstormings nach Osborn/Clark eingesetzt. Ursprünglich wurde diese Methode entwickelt, um konkrete Problemlösungen zu generieren. Ziel dieses Ansatzes ist jedoch, „wirklich gute Probleme“ zu identifizieren. Ein solches Problem besteht auf dem Markt, den das Unternehmen bedient, ist aber bislang noch nicht zufriedenstellend gelöst. Dabei zeigt sich häufig, dass auch branchenfremde Herausforderungen mit den eigenen Kompetenzen angegangen werden können. So entstehen echte Innovationen, die es ermöglichen, neue Märkte zu erschließen. Zur Auflockerung treten die Gruppen in einem Wettbewerb gegeneinander an.
Aus der Praxis
Ein Hamburger IT-Beratungsunternehmen erlebte im Rahmen der Problemolympiade eine Überraschung. Eigentlich rechnete das Unternehmen damit, dass ungelöste IT-Probleme angesprochen werden. Doch das Hauptthema der Kunden waren die hohen Anfangsinvestitionen von IT-Projekten, weshalb sie oftmals verschoben wurden. Das Unternehmen reagierte innovativ und bot beispielsweise einem Startup für die Finanzierung seines Online-Handels an. Das Startup beteiligte das IT-Unternehmen an jedem verkauften Produkt anteilig und sparte damit die hohe Anfangsinvestition eines professionellen Online-Shops. Mit dieser Innovation konnte das IT-Unternehmen seinen Umsatz innerhalb kürzester Zeit verdoppeln, weil Kunden viel schneller Projekte in Auftrag gaben.
■ Expertencafé
Bei dieser Methode wird das klassische „Knowledge Café“ genutzt, wobei die Rolle des „Caféinhabers“ neu interpretiert wird: Anstelle eines neutralen Moderators agiert er als Fachexperte. Die Fachkräfte des Unternehmens verteilen sich an die Tische und stehen den Kunden dort zu spezifischen Themen Rede und Antwort. Aus den Kundenfragen entstehen Rohthemen, die am Tisch auf Papierdecken festgehalten werden. Die Gruppen wechseln von Tisch zu Tisch, informieren sich über die Arbeit der vorherigen Gruppe und ergänzen das aktuelle Thema durch eigene Fragen und Impulse.
Aus der Praxis
Ein Touristik-Unternehmen staunte, als die geladenen Reisebüroleiter reihum über viel zu hohe Preise für Kreuzfahrten diskutierten. Man erkannte daraus einen Trend hin zu „bezahlbaren Kreuzfahrten“. Im Anschluss des Kundenworkshops wurde ein Konzept für „Familienkreuzfahrten“ umgesetzt. Das Unternehmen hatte richtig zugehört und betreibt heute eine familienfreundliche Kreuzfahrtflotte mit zwölf Schiffen.
■ Marktplatz der Inspirationen
Am Ende der Veranstaltung wird der Veranstaltungsraum in einen lebendigen Marktplatz verwandelt. Inspiriert von der Open Space Methode (Harrison Owen) präsentieren die Kunden an Ständen, wie sie die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens nutzen. Die Experten agieren dabei als Besucher des Marktplatzes, informieren sich an den Ständen und sammeln neue Inspirationen. Dieser umgekehrte Austausch fördert die Innovationsarbeit zusätzlich und sorgt für einen dynamischen Abschluss der Veranstaltung.
Aus der Praxis
Ingenieure eines Unternehmens für Holzbearbeitungsmaschinen stellten amüsiert fest, dass ein Kunde eine Anlage völlig zweckentfremdet hatte. Sie kamen mit dem Kunden ins Gespräch. Was zunächst wie ein Workaround aussah, entpuppte sich für das Unternehmen als echte Innovation. Inspiriert von der Idee, die dieser zweckentfremdeten Anlage zugrunde lag, entwickelte man ein völlig neue Produktreihe, die schnell reißenden Absatz fand.
Der steinige Weg zur Innovation
Ein Kundenworkshop allein führt in der Regel noch nicht zu fertigen Produkten oder Innovationen, sondern vielmehr zu einer Sammlung von Rohideen, die anschließend zu marktfähigen Innovationen weiterentwickelt werden müssen. Der Workshop mit den eigenen Kunden stellt dabei nur den zweiten Schritt in einem sechsstufigen Prozessmodell dar:
■ Vorbereitung. Das Ziel der Vorbereitungsphase ist die klare Definition der Workshopziele. Diese Ziele bilden die Grundlage für die Auswahl und Gestaltung der eingesetzten Methoden und sorgen dafür, dass der Workshop fokussiert und zielgerichtet verläuft.
■ Generierung. Im Workshop treffen Kunde und Unternehmen aufeinander, tauschen sich aus, diskutieren aktuelle Trends und erarbeiten gemeinsam innovative Lösungsansätze. Diese Generierungsphase fördert den Ideenaustausch und legt die Grundlage für mögliche Innovationen.
■ Beurteilung. Der Folgetag ist mindestens ebenso erfolgskritisch wie der Kundenworkshop selbst. Nun geht es um die systematische Bewertung und Priorisierung der im Workshop gesammelten Rohideen. Am Folgetag werden diese Ideen sortiert, gefiltert und nach Kriterien wie Marktrelevanz, Trends oder technischer Umsetzbarkeit geordnet.
■ Umsetzung. Nachdem die Geschäftsführung den aussichtsreichsten Ideen Projektbudgets zugewiesen hat und konkrete Innovationsprojekte auf den Weg gebracht wurden, entstehen in der Umsetzungsphase nun greifbare Innovationen.
■ Stabilisierung. In der abschließend stattfindenden Stabilisierungsphase sorgen Anwendungstests für die Beseitigung letzter Schwierigkeiten, um die Innovationen entweder als Prozess in den Regelbetrieb oder als Produkt in den Verkaufsprozess zu überführen.
Der Co-Creation Prozess dient vor allem dazu, wertvolle Rohideen zu sammeln und den Innovationsprozess anzustoßen. Er ist nur ein wichtiger Schritt in einem mehrstufigen Verfahren, bei dem die gesammelten Ideen weiterentwickelt und zur Marktreife gebracht werden. Damit zeigt sich, dass Kundenfeedback eine wichtige Grundlage für nachhaltige Innovationen ist.